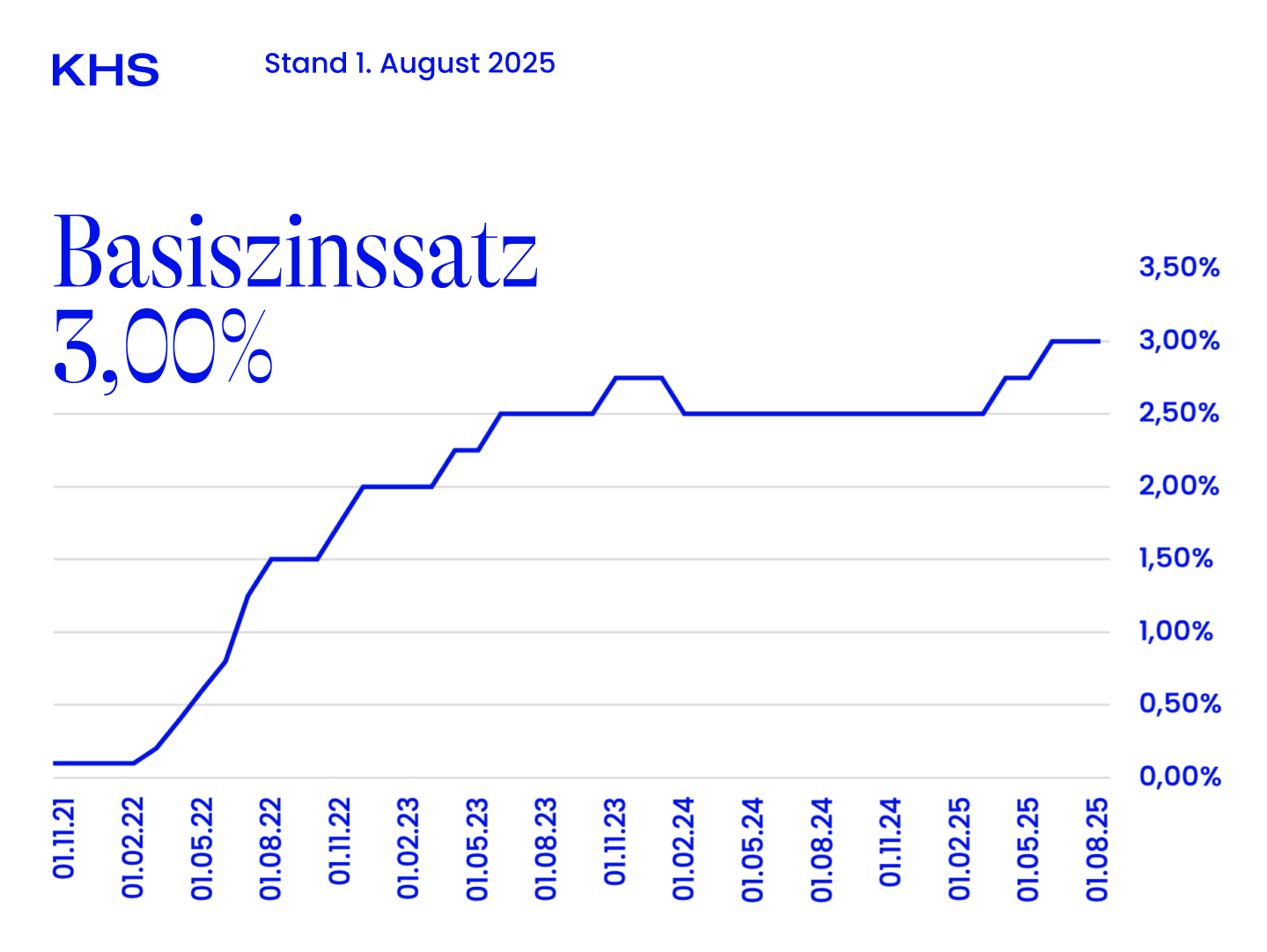Wer junge Menschen ins Unternehmen holt, investiert in die Zukunft. Ob als Werkstudent:innen, Praktikant:innen oder Schüler:innen – engagierter Nachwuchs bringt frischen Wind und neue Ideen mit. Damit die Zusammenarbeit nicht nur fachlich, sondern auch rechtlich rundläuft, sollten Arbeitgebende die wichtigsten Regelungen zur Abrechnung dieser Beschäftigungsverhältnisse kennen. Denn abhängig vom Status gibt es Unterschiede bei Sozialabgaben, Steuern, Mindestlohn und Versicherungen. In diesem Beitrag erfahren Sie kompakt und verständlich, worauf es bei der korrekten Abrechnung von Werkstudent:innen, Praktikant:innen und Schüler:innen ankommt.
Rechtliche Grundlagen: Der Rahmen für die Beschäftigung
Die rechtssichere Abrechnung junger Mitarbeitenden beruht auf verschiedenen Gesetzen. Dazu gehören unter anderem das Sozialgesetzbuch (SGB), das Einkommensteuergesetz (EStG), das Mindestlohngesetz (MiLoG) sowie das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Bei Schüler:innen gilt ergänzend das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Die Einordnung der Beschäftigungsart – ob Pflichtpraktikum, freiwilliges Praktikum, Werkstudent:innentätigkeit oder Schüler:innenjob – hat direkte Auswirkungen auf die lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung. Das klingt zunächst vielleicht komplex, ist mit etwas Struktur und dem richtigen Überblick jedoch gut umsetzbar.
Werkstudent:innen: Flexibel und mit Vorteilen für beide Seiten
Werkstudent:innen sind ordentlich immatrikulierte Studierende, die neben dem Studium (während der Vorlesungszeit) bis zu 20 Stunden pro Woche arbeiten dürfen. Diese Begrenzung stellt sicher, dass das Studium weiterhin im Mittelpunkt steht. In der vorlesungsfreien Zeit oder an den Wochenenden darf auch mehr gearbeitet werden – allerdings immer noch begrenzt, damit der Werkstudent:innenstatus erhalten bleibt (→ 26-Wochen-Regel). Ein besonderer Vorteil: Werkstudent:innen sind von der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung befreit. Es fallen lediglich Rentenversicherungsbeiträge an. Damit sind Werkstudent:innen für Unternehmen nicht nur flexibel einsetzbar, sondern auch kosteneffizient. Sofern das regelmäßige monatliche Einkommen nicht mehr als 535 Euro beträgt (556 Euro bei Ausübung eines Minijobs) und der Student / die Studentin jünger als 25 Jahre alt ist, kann er / sie sogar kostenlos familienversichert bleiben. Bei Überschreiten dieser Grenze bzw. des Alters muss der Student / die Studentin sich selbst in der Kranken- und Pflegeversicherung der Studenten (KVdS) versichern. Bei der Unfallversicherung über die zuständige Berufsgenossenschaft und den verschiedenen Umlageverfahren (U1 bis U3) gelten die selben Grundsätze wie bei gewöhnlichen Beschäftigten (Beiträge ausschließlich arbeitgeberfinanziert).
Wichtig zum Umlageverfahren (U1, U2, U3):
- U1 (Krankheit): Pflicht bei weniger als 30 Beschäftigten
- U2 (Mutterschaft): Pflicht für alle Arbeitgebende
- U3 (Insolvenzgeld): Pflicht für alle Arbeitgebende
Unser Tipp: Arbeitgebende sollten regelmäßig die Immatrikulationsbescheinigung einholen und die 20-Stunden-Grenze bzw. die 26-Wochen-Regelung im Blick behalten.
Praktikant:innen: Lernen im Betrieb – aber richtig abgerechnet
Praktika bieten Studierenden wichtige Einblicke in die Praxis und Unternehmen die Chance, junge Talente kennenzulernen. Je nach Art des Praktikums gelten unterschiedliche Regelungen:
- Pflichtpraktika, die im Rahmen einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben sind und während des Studiums absolviert werden (Zwischenpraktikum), sind sozialversicherungsfrei – unabhängig davon, ob sie vergütet werden oder nicht. Umlagen (U1 bis U3) fallen dagegen auch bei Sozialversicherungsfreiheit an, wenn ein Entgelt gezahlt wird.
- Freiwillige Praktika, die nicht vorgeschrieben sind und für die ein Entgelt gezahlt wird, gelten als reguläre Beschäftigung. Sie können als geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob), als kurzfristige Beschäftigung, als Werkstudentenbeschäftigung oder als Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigung ausgeübt werden. Es gelten sodann die jeweiligen (speziellen) Regelungen. Wenn dagegen kein Entgelt gezahlt wird, entfällt die Sozialversicherungspflicht und Umlagebeiträge müssen nicht abgeführt werden. Ob ein Entgelt gezahlt werden muss, bestimmt sich nach dem Mindestlohngesetz. Dabei ist regelmäßig entscheidend, ob das Praktikum länger als drei Monate andauert. Sofern es länger als drei Monate andauert, ist grundsätzlich ab dem ersten Tag des Praktikums mit dem Mindestlohn zu vergüten und Sozialversicherungsbeiträge inklusive Umlagebeiträge sind abzuführen. Bei einem Pflichtpraktikum besteht hingegen auch bei einer Dauer von über drei Monaten kein Mindestlohnanspruch.
Die Unterscheidung zwischen einem freiwilligen Praktikum und einem Pflichtpraktikum kennt das Unfallversicherungsrecht nicht. Unfallversicherungsschutz besteht stets für das Praktikumsunternehmen, wobei eine Meldung an die Berufsgenossenschaft nur erforderlich ist, wenn ein Entgelt gezahlt wird.
Auch bei Praktikant:innen gilt: Die genaue Einordnung und Dokumentation des Beschäftigungsverhältnisses inkl. Durchsicht der jeweiligen Prüfungsordnung sind unerlässlich.
Schüler:innen: Erste Berufserfahrung sicher und fair ermöglichen
Für viele Schülerinnen und Schüler ist ein Ferienjob der erste Kontakt zur Arbeitswelt. Damit der Einstieg gelingt, gelten alters- und zeitabhängige Regeln. Kinder über 13 Jahren dürfen mit Einwilligung der Eltern stundenweise beschäftigt werden, soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Die zulässigen Beschäftigungen sind in der Kinderarbeitsschutzverordnung geregelt. Dazu gehören typischerweise das Austragen von Zeitungen, Erteilung von Nachhilfe, Babysitten sowie Betreuung und Pflege von Haustieren.
Darüber hinaus dürfen schulpflichtige Kinder ab 15 Jahren in den Ferien arbeiten – allerdings nur maximal vier Wochen pro Kalenderjahr. Die tägliche Arbeitszeit ist auf acht Stunden begrenzt, Nacht-, Wochenend- und gefährliche Arbeiten sind nicht erlaubt.
Solche Beschäftigungen sind grundsätzlich auch sozialversicherungspflichtig, wobei sie in aller Regel als geringfügige Beschäftigung (Minijob) zu behandeln sind, wenn nicht von vornherein nur eine kurzfristige Beschäftigung vorliegt. Bei kurzfristiger Beschäftigung – maximal 70 Arbeitstage oder drei Monate pro Jahr – besteht keine Sozialversicherungspflicht, sofern die Tätigkeit nicht berufsmäßig ist. Wird ein Minijob mit bis zu 556 Euro monatlich vereinbart, fallen pauschale Abgaben für den Arbeitgebenden an (13 % KV, 15 % RV, 2 % Steuer).
Unabhängig von der Beschäftigungsart ist eine Unfallversicherung über die Berufsgenossenschaft Pflicht. Auch die Anmeldung bei der Minijob-Zentrale darf nicht vergessen werden.
Steuerliche Freibeträge: Geringes Einkommen – wenig oder keine Steuer
Viele junge Menschen verdienen mit ihren Nebentätigkeiten nur kleine Beträge, weshalb oft keine oder nur sehr geringe Lohnsteuern anfallen. Der Grundfreibetrag beträgt aktuell 12.096 Euro pro Jahr. Hinzu kommen eine Werbungskostenpauschale (1.230 Euro) und eine Sonderausgabenpauschale (36 Euro).
Gerade für Werkstudent:innen und Schüler:innen in Steuerklasse I bedeutet das: Solange sie unterhalb dieser Grenzen bleiben, wird keine Lohnsteuer fällig.
Das sollten Arbeitgebende im Blick behalten
Wer junge Menschen beschäftigt, trägt auch Verantwortung – insbesondere für die rechtssichere Durchführung. Arbeitgebende sollten daher die Art der Beschäftigung genau prüfen und alle nötigen Nachweise rechtzeitig einholen. Dazu gehören etwa Immatrikulationsbescheinigungen, Schulnachweise oder Studienordnungen. Auch die Erfassung der Arbeitszeit sowie die Einhaltung von Arbeitszeitregelungen, insbesondere bei Werkstudent:innen und Schüler:innen gehören zu den Grundpflichten.
Fazit: Klare Regeln – faire Chancen
Die Beschäftigung von Werkstudent:innen, Praktikant:innen und Schüler:innen ist eine Win-win-Situation – für junge Menschen ebenso wie für Unternehmen. Wer die rechtlichen Rahmenbedingungen kennt und sauber umsetzt, schafft Transparenz, Rechtssicherheit und Vertrauen. Mit guter Planung und strukturierter Abrechnung wird aus einem Nebenjob oder Praktikum oft mehr: ein wertvoller Einstieg in eine berufliche Zukunft – vielleicht sogar im eigenen Unternehmen.
Sie möchten sichergehen, dass Sie alle Anforderungen korrekt umsetzen? Wir beraten Sie gerne individuell zu Ihrem konkreten Fall.